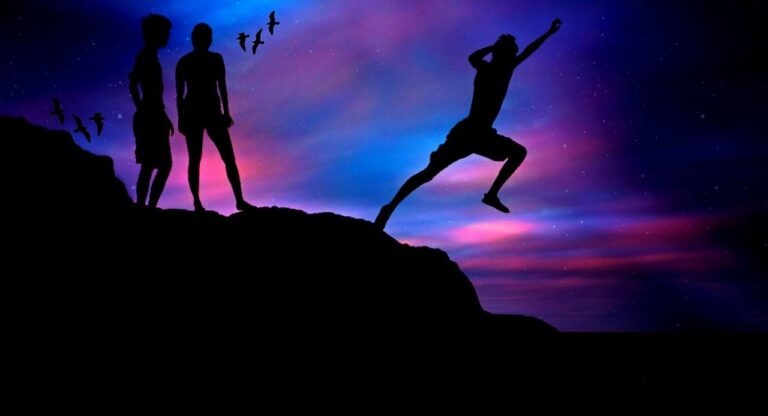Glaube an die leibhafte Auferstehung – Predigt am 3. Sonntag der Osterzeit LJ B

Angst und Furcht prägt die Jünger „Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen.“ Lk 24,37 In dieser Weise werden die Jünger beschrieben, die versammelt sind, um Unglaubliches zu hören. Die beiden Jünger, die auf…